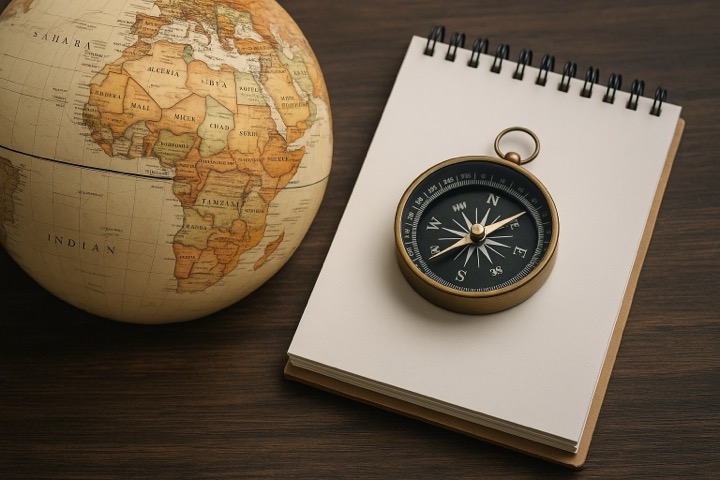Berlin war im Mai 2025 Gastgeber eines bedeutenden gesellschaftspolitischen Ereignisses: der Dekolonialen Konferenz, die von der afrikanischen Diaspora maßgeblich mitgestaltet wurde. Über 300 Delegierte aus rund 40 Ländern kamen zusammen, um 140 Jahre nach der historischen Berliner Kongo-Konferenz (1884/85) über das koloniale Erbe, strukturellen Rassismus, kulturelle Rückgabe und globale Gerechtigkeit zu debattieren.
Ein historischer Ort mit brisanter Vergangenheit
Die Konferenz fand unweit des Ortes statt, an dem einst europäische Mächte Afrika unter sich aufteilten. Diese geografische Nähe war bewusst gewählt. Die Veranstalter – darunter der Ökumenische Rat der Kirchen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Aktivist*innen der afrikanischen Diaspora – wollten mit der Wahl des Ortes ein starkes Zeichen setzen: Europa muss sich seiner kolonialen Geschichte stellen und daraus Verantwortung übernehmen.
Erinnern, Aufarbeiten, Umgestalten
Die Konferenz verfolgte mehrere Hauptziele: Die kritische Auseinandersetzung mit kolonialen Kontinuitäten, die Sichtbarmachung der Perspektiven afrikanischer Gemeinschaften und die Entwicklung konkreter Forderungen an Politik und Gesellschaft.
Im Zentrum standen folgende Themenfelder:
- Restitution von Kulturgütern und menschlichen Überresten
- Reparationen und faire wirtschaftliche Beziehungen
- Umbenennung kolonial belasteter Straßennamen und Denkmäler
- Rassismuskritische Bildung und Reform des Geschichtsunterrichts
- Stärkung diasporischer Netzwerke und Selbstorganisation
Forderungen an Europa – Ein Manifest der Gerechtigkeit
Im Laufe der Konferenz wurde ein gemeinsames Forderungspapier verabschiedet. Es fordert von europäischen Staaten eine klare politische Anerkennung kolonialer Schuld, die Rückgabe sämtlicher während der Kolonialzeit geraubter Kulturgüter und eine gerechtere Wirtschaftsordnung.
„Gerechtigkeit ist nicht nur eine moralische Frage, sondern eine strukturelle Notwendigkeit“, betonte eine Sprecherin der panafrikanischen Jugenddelegation. Die Diaspora wolle keine Almosen, sondern ein Ende kolonialer Machtverhältnisse im Handel, im Finanzsystem und in der internationalen Politik.
Internationale Stimmen und Perspektiven
Die Konferenz wurde durch Beiträge namhafter Expert*innen geprägt, darunter der britische Journalist Gary Younge, die südafrikanische Soziologin Pumla Dineo Gqola und die kamerunische Menschenrechtsanwältin Alice Nkom. Sie betonten die Wichtigkeit globaler Solidarität, aber auch die Selbstermächtigung afrikanischer Communities weltweit.
Insbesondere junge Vertreter*innen betonten, dass Dekolonialisierung nicht nur in Museen und Universitäten stattfinden dürfe. Vielmehr müsse sie in Bildung, Stadtentwicklung, Medien und internationaler Klimapolitik konsequent mitgedacht werden.
Zwischen Erinnerungskultur und konkreter Transformation
Viele Panels thematisierten auch die Rolle von Erinnerung im öffentlichen Raum. Diskutiert wurde unter anderem die Zukunft kolonial belasteter Denkmäler und Straßennamen. Während einige Stimmen ihre Entfernung forderten, plädierten andere für kontextualisierende Ergänzungen, um historische Bildung zu fördern.
Eine häufig genannte Forderung: Die Einführung eines bundesweiten „Tages der Dekolonialisierung“ zur Reflexion und Auseinandersetzung mit Deutschlands kolonialer Vergangenheit – nicht nur in Berlin, sondern auch in Städten wie Hamburg, Bremen oder Leipzig.
Gesellschaftliche Reaktionen: Zustimmung und Kritik
Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 65 % der deutschen Bevölkerung eine stärkere Aufarbeitung des Kolonialismus befürworten. Gleichzeitig sprechen sich lediglich 28 % für eine vollständige Rückgabe kolonialer Kulturgüter aus – ein Spannungsfeld, das sich auch in politischen Reaktionen widerspiegelt.
Kritik kam unter anderem von konservativen Think-Tanks, die der Konferenz vorwarfen, einseitig zu sein und wirtschaftliche Partnerschaften mit afrikanischen Staaten zu wenig zu würdigen. Sie plädierten stattdessen für eine Betonung positiver Entwicklungen wie technologische Zusammenarbeit und bilaterale Entwicklungshilfe.
Migration, Klimakrise und Dekolonialisierung
Ein bislang wenig beachteter Aspekt, der in mehreren Workshops beleuchtet wurde, ist der Zusammenhang zwischen Klimagerechtigkeit und Kolonialismus. Umweltveränderungen treffen afrikanische Länder besonders hart – viele Teilnehmende sehen darin eine Folge jahrhundertelanger Ausbeutung von Ressourcen durch den Globalen Norden.
Zudem wurden aktuelle Migrationsabkommen zwischen der EU und afrikanischen Staaten kritisch analysiert. Aktivist*innen bezeichneten Abschiebeabkommen als „neokoloniale Kontrolle über Mobilität“ und forderten stattdessen legale Migrationswege sowie ein Ende rassistischer Grenzpraktiken.
Intersektionale Perspektiven: Queer, Kunst, Widerstand
Ein besonders bemerkenswerter Programmpunkt war die Einbindung queerer, künstlerischer und feministischer Stimmen. So wurden unter anderem queere Lesarten von Kolonialismus thematisiert, die bislang wenig Aufmerksamkeit erhalten. Auch Performancekunst spielte eine zentrale Rolle – etwa in Beiträgen von Künstler*innen wie Grada Kilomba, die mit Bühneninstallationen Erinnerung und Widerstand miteinander verbindet.
Begleitend zur Konferenz fand zudem das Afrolution Festival statt, das Musik, Literatur und politische Debatte zusammenführte. Dieses Format schuf einen niederschwelligen Zugang zu komplexen Themen und band junge Menschen aktiv ein.
Transnationale Bündnisse & Zukunftspläne
Die Berliner Konferenz war nicht alleinstehend. Delegationen kündigten bereits weitere Veranstaltungen in London, Paris und Johannesburg an. Ziel sei es, bis 2026 einen transnational abgestimmten „Dekolonialen Fahrplan“ zu entwickeln – mit konkreten Leitlinien für Bildungspläne, Rückgabeverfahren, finanzielle Reparationen und institutionelle Reformen.
Langfristig sollen auch multilaterale Organe wie die Vereinten Nationen eingebunden werden. Ein UN-Sonderausschuss zur Kolonialverantwortung ist in Planung. Dieser könnte als Monitoringstelle für Fortschritte und Rückschritte dienen – ein Vorhaben, das von weiten Teilen der Zivilgesellschaft unterstützt wird.
Fazit: Ein Wendepunkt für die Erinnerungskultur?
Die Dekoloniale Konferenz in Berlin 2025 war mehr als eine akademische Veranstaltung – sie war ein lautstarkes Signal an die Politik, die Erinnerungskultur, das Bildungswesen und die globale Öffentlichkeit. Die afrikanische Diaspora forderte nicht nur Gerechtigkeit, sondern präsentierte konkrete Konzepte für eine faire und gleichberechtigte Zukunft.
„Dekolonisation ist kein Akt der Großzügigkeit, sondern der Gerechtigkeit“, lautete eine der zentralen Aussagen der Abschlussveranstaltung.
Ob die Forderungen in politische Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt offen. Doch eines ist sicher: Die Stimmen der afrikanischen Diaspora sind nicht mehr zu überhören. Die Berliner Konferenz war ein Ausdruck dieser neuen Selbstverständlichkeit – und möglicherweise der Beginn einer dauerhaft veränderten Erinnerungspolitik in Europa.