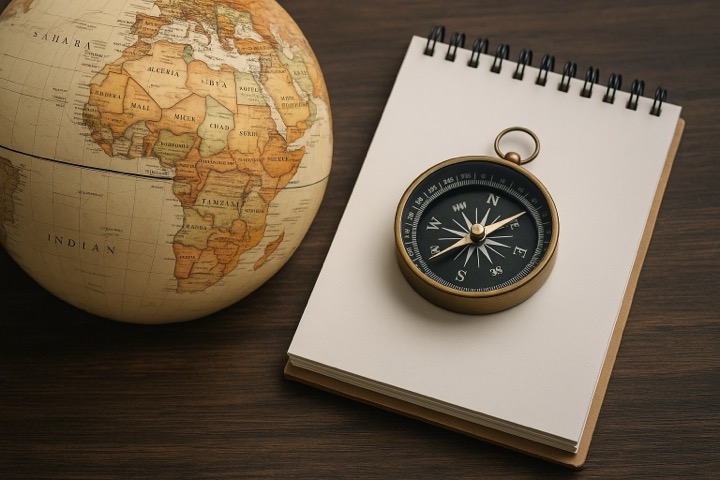Die Ausstellung „Planet Africa – Eine archäologische Zeitreise“ in der Archäologischen Staatssammlung München öffnet ein neues Kapitel in der Präsentation afrikanischer Geschichte und Kultur. Sie bietet eine faszinierende Reise durch Jahrtausende afrikanischer Entwicklung und richtet sich dabei insbesondere an in Deutschland lebende Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Ziel der Ausstellung ist es, nicht nur ein breites Publikum für die afrikanische Vergangenheit zu sensibilisieren, sondern auch Identifikationspunkte zu schaffen – durch eine bewusst vielfältige, künstlerisch wie wissenschaftlich tiefgründige Herangehensweise.
Ein interkontinentales Gemeinschaftsprojekt
Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit Institutionen aus verschiedenen afrikanischen Ländern – darunter Ghana, Eswatini, Kenia, Mosambik und Marokko. Auch deutsche Institutionen wie das Deutsche Archäologische Institut und die Staatlichen Museen zu Berlin sind beteiligt. Diese interkulturelle Kooperation sorgt für eine authentische, multiperspektivische Erzählweise und ermöglicht eine Repräsentation afrikanischer Geschichte, die sich von klassischen eurozentrischen Deutungsmustern löst.
In afrikanischen Ländern wird die Ausstellung unter dem Titel „Planet Africa on Tour“ digital gezeigt. Lokale Partnerinstitutionen nutzen dafür flexible Präsentationsformate: Aufbereitete Filme, Infografiken, Illustrationen und Street-Art-Elemente können vor Ort ausgedruckt oder über Bildschirme gezeigt werden. So lässt sich das Material an lokale Bedingungen anpassen – ein Modell, das auch in der Vermittlung von kulturellem Erbe in anderen Regionen Schule machen könnte.
Sechs Module als thematische Wegweiser
Die Ausstellung ist in sechs klar strukturierte Module unterteilt, die sowohl chronologisch als auch thematisch durch die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung Afrikas führen. Dabei stehen zentrale Fragen im Vordergrund: Was bedeutet es, in Afrika zu leben? Welche Herausforderungen und Innovationen haben Gesellschaften dort geprägt? Wie lassen sich Kontinuitäten über Zeit und Raum hinweg darstellen?
1. Vielfalt – Natürlicher Reichtum durch Diversität
Im ersten Modul wird die geographische und ökologische Vielfalt Afrikas thematisiert. Unterschiedlichste Klimazonen, Tier- und Pflanzenwelten sowie kulturelle Traditionen führten zur Entwicklung unterschiedlichster Lebensweisen – von nomadischer Viehzucht bis zu hochentwickelten urbanen Gesellschaften.
2. Menschwerdung – Erste entscheidende Schritte
Dieses Modul beleuchtet die Wiege der Menschheit. Afrika als Ursprungsort der Gattung Homo wird mit neuesten archäologischen und paläoanthropologischen Erkenntnissen untermauert. Fossile Funde und Rekonstruktionen verdeutlichen die gemeinsamen Wurzeln der Menschheit und bieten eine eindrucksvolle Perspektive auf unsere Herkunft.
3. Gewusst wie – Agiles Wissen & flexible Technik
Hier wird der Fokus auf technologische Erfindungen, handwerkliches Können und überregionale Wissensvernetzungen gelegt. Werkzeuge, Webtechniken und agrarische Innovationen zeigen, wie flexibel sich afrikanische Gesellschaften an neue Herausforderungen angepasst haben.
4. Zeichen & Bilder – Wissen wird visualisiert
Symbole, Malereien, Schriftformen und künstlerische Ausdrucksformen verdeutlichen die Visualisierung von Wissen. Frühformen von Schrift, aber auch Bildsprache in Ritualen, auf Masken oder Textilien vermitteln die Bedeutung visueller Kommunikation in vor- und frühgeschichtlicher Zeit.
5. Rohstoffe – Austausch, Handel, Macht
Ein zentrales Thema ist der historische Reichtum Afrikas an Ressourcen wie Gold, Salz, Eisen und Elfenbein. Handelsnetzwerke quer über den Kontinent – von Timbuktu bis Sansibar – zeugen von dynamischen Wirtschaftsstrukturen. Der transsaharische Handel sowie Kontakte zu arabischen und später europäischen Kulturen werden hier sichtbar gemacht.
6. Neue Perspektiven – Afrikanische Archäologie heute
Das letzte Modul betont die Arbeit zeitgenössischer afrikanischer Archäologen. Diese nehmen zunehmend selbst die Deutungshoheit über ihre Geschichte in die Hand. Damit entsteht eine neue Forschungskultur, die sich mit postkolonialen Fragestellungen und der Rückführung afrikanischer Kulturgüter auseinandersetzt.
Street-Art trifft auf Wissenschaft
Ein besonderes Merkmal der Ausstellung ist der gezielte Einsatz afrikanischer Street-Art. Wandbilder, Graffiti und digitale Illustrationen begleiten die wissenschaftlichen Exponate und ermöglichen eine emotionale Ansprache jüngerer Generationen. Die Kunst wird damit nicht nur zum Vermittlungsinstrument, sondern zum gleichwertigen Bestandteil des historischen Diskurses.
„Wir wollten kein Museum der kolonialen Betrachtung, sondern eine Bühne für die afrikanische Perspektive schaffen.“
So äußerte sich ein an der Ausstellung beteiligter Kurator und verweist auf den Anspruch, mit dem Projekt koloniale Sichtweisen aufzubrechen.
Einbindung afrikanischer Communities in Deutschland
Die Ausstellung versteht sich auch als Brücke zu afrikanischen Diaspora-Communities in Deutschland. Für viele Menschen mit afrikanischen Wurzeln ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft oft fragmentiert. „Planet Africa“ bietet hier einen Raum zur Stärkung kultureller Identität und ein Forum für Austausch.
Durch spezielle Angebote wie Workshops, Führungen in verschiedenen Sprachen und Bildungsprogramme für Schulklassen wird die Ausstellung aktiv in den Alltag eingebunden. In Zusammenarbeit mit der Münchner Volkshochschule wurden spezielle Führungen und Diskussionsformate entwickelt. Auch ein Mitmachheft für Kinder schafft niedrigschwellige Zugänge für Familien.
Didaktik und Vermittlung
Die Ausstellung legt großen Wert auf barrierefreie und didaktisch durchdachte Vermittlung. Neben klassischen Wandtexten kommen interaktive Stationen, Tastmodelle, Audioguides in mehreren Sprachen und digitale Anwendungen zum Einsatz. So wird auch Besuchern ohne wissenschaftlichen Hintergrund ein fundierter Zugang ermöglicht.
| Element | Vermittlungsform |
|---|---|
| Street-Art | Emotionale Ansprache und künstlerische Reflexion |
| Workshops | Interaktive Lernerfahrung für Kinder und Jugendliche |
| Digitale Module | International adaptierbare Bildungsbausteine |
| Vorträge | Wissenschaftlicher Tiefgang und Diskussion |
Kritische Stimmen und offene Fragen
So viel Anerkennung die Ausstellung auch erhält – es gibt auch kritische Stimmen. Einige Beobachter bemängeln, dass der transatlantische und transsaharische Sklavenhandel nur oberflächlich thematisiert werde. Die langfristigen gesellschaftlichen und demografischen Folgen dieser Jahrhunderte währenden Ausbeutung könnten stärker in den Fokus rücken. Andere hingegen loben gerade die Entscheidung, den Fokus nicht ausschließlich auf Kolonialismus und Sklaverei zu richten, sondern auch Errungenschaften, Innovationen und Alltagsrealitäten in den Vordergrund zu stellen.
Diese Debatte spiegelt eine größere Bewegung in der Museumswelt: Die Frage, wie koloniale Vergangenheit dargestellt werden kann, ohne den gesamten Kontinent auf Leiden und Verlust zu reduzieren. „Planet Africa“ geht hier einen Mittelweg, der weiterhin zur Diskussion anregen wird.
Ein Vorbild für zukünftige Ausstellungen
Die konzeptionelle und technische Umsetzung von „Planet Africa“ wurde bereits mit dem „Goldenen Nagel“ des Art Directors Club Deutschland ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die emotionale Zugänglichkeit, das modulare Ausstellungskonzept und die enge Einbindung afrikanischer Akteure.
Dieses Projekt kann als Vorbild für weitere transkulturelle Ausstellungen dienen – nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit. Es verdeutlicht, wie Wissensvermittlung über Grenzen hinweg funktionieren kann, ohne in Klischees zu verfallen oder westliche Interpretationshoheit zu manifestieren.
Fazit: Eine Zeitreise mit Tiefgang und Verantwortung
„Planet Africa – Eine archäologische Zeitreise“ ist mehr als eine Ausstellung: Sie ist ein Dialograum, ein Lernort und ein Zeichen dafür, dass afrikanische Geschichte, Identität und Gegenwart nicht länger marginalisiert, sondern selbstbewusst erzählt werden. Für afrikanischstämmige Menschen in Deutschland bietet sie eine emotionale wie intellektuelle Rückverbindung – und für alle anderen eine Gelegenheit, das eigene Wissen zu erweitern und Vorurteile zu hinterfragen.
In einer Zeit, in der kulturelle Vielfalt oft politisiert wird, setzt diese Ausstellung ein Zeichen für Respekt, Neugier und wissenschaftlich fundierten Austausch. Sie erinnert daran, dass Geschichte nicht statisch ist – sondern ein Prozess, an dem viele beteiligt sind.